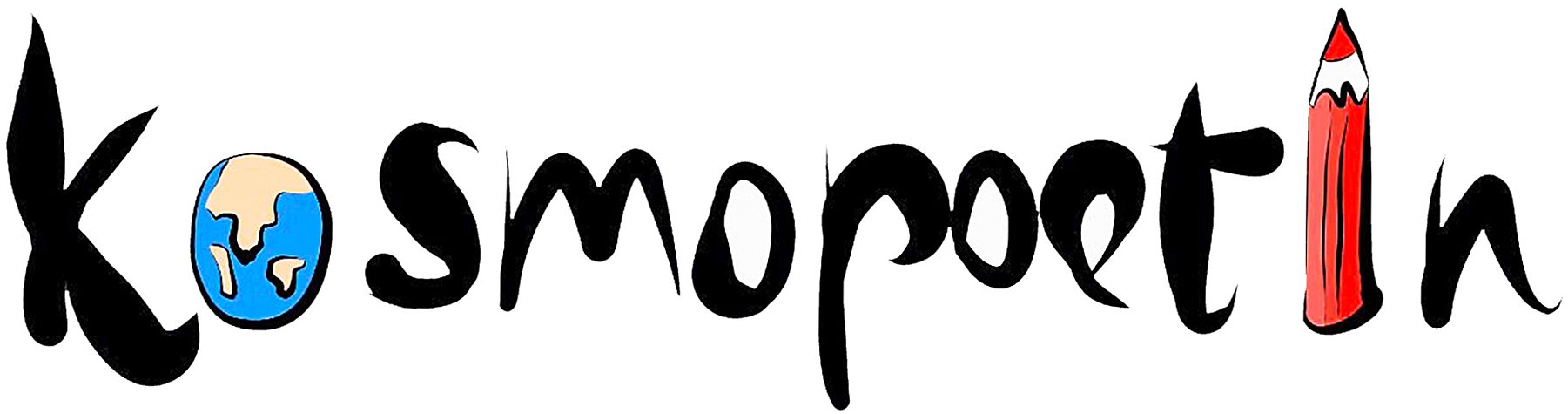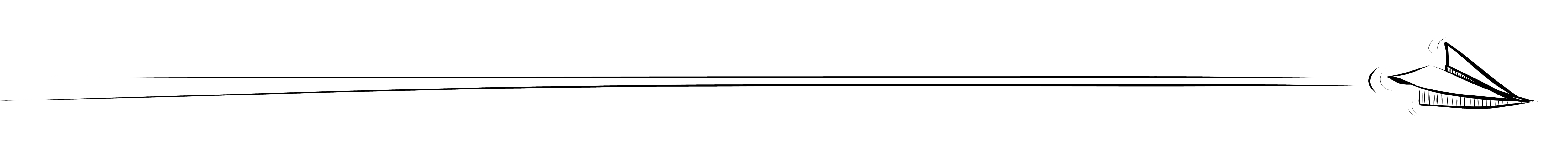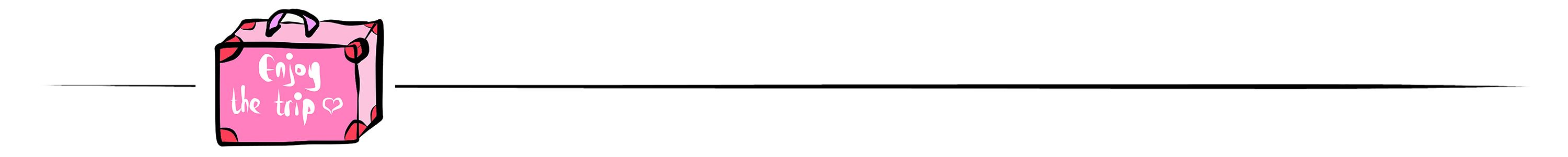Leipzig ist eine Musikstadt. Doch anders als vermutet haben nicht nur Männer Musikgeschichte geschrieben. Ob Clara Schumann, Cécile Mendelssohn Bartholdy oder Anna Magdalena Bach: Viele Frauen haben Leipzig geprägt, obwohl sie unbeachtet im Schatten der Männer standen. Ein Blick auf weibliche Lebenswelten und starke Frauen in Leipzig – und wo man ihnen heute begegnet.

Frauen in der Musik in Leipzig: Auf den Spuren starker Frauen in Leipzig ♥ Lesezeit: 10 Minuten
Die Haare gescheitelt, die Haltung aufrecht, die Miene ernst. Schon im Alter von neun Jahren wirkt Clara Wieck wie eine kleine Erwachsene, die ernst ihrer Zukunft entgegenblickt. Dass sie eines Tages zu einem der bekanntesten Liebespaare des 19. Jahrhunderts zählen wird, ahnt sie als Kind allerdings noch nicht. Da sind ihre Tage gefüllt mit Klavier- und Geigespielen, Instrumentieren und Partiturlesen, Gesangs- und Theorieunterricht.

Clara Wiek spielt Klavier, ehe sie sprechen kann. Und wird zum Wunderkind, geformt von ihrem Vater. Schon vor ihrer Geburt bestimmt Friedrich Wieck sie zur Pianistin. Als sie fünf Jahre alt ist, holt er seine Tochter zu sich und beginnt sie zu fördern – und zu formen. Er will sie so rasch wie möglich als Wunderkind und Klaviervirtuosin bekannt machen. Mit neun gibt sie ihr erstes Konzert. Friedrich Wieck schreibt an seine Frau: „Claras musikalische Ausbildung (nicht allein als Virtuosin) findet jeder hier für fabelhaft (…) Auch wissen nachher die Leute nicht, wen sie mehr bewundern sollen, ob das Kind oder den Vater als Lehrer (…) Die allergrößten Klavierspieler wollen bei mir Stunden nehmen …“



Frauen in der Musik in Leipzig: Schumann-Haus
Friedrich Wieck liegt richtig. Einer dieser Klavierspieler ist Robert Schumann. Der talentierte Pianist zieht ins Wiecksche Hause, um Unterricht bei Friedrich Wieck zu nehmen. Clara ist elf Jahre alt, Schumann fast doppelt so alt. Die beiden mögen sich, sind verbunden durch die Musik. Womit Wieck nicht gerechnet hat: Clara und Robert verlieben sich ineinander, als sie 16 ist. Er tut alles, um seine Tochter von der Heirat abzuhalten: „Wenn Clara Schumann heiratet, so sag ich es noch auf dem Totenbett, sie ist nicht wert, meine Tochter zu sein.“




Doch das Liebespaar ist überzeugt von einer gemeinsamen Zukunft. Clara schwärmt: „Roberts Liebe beglückt mich unendlich!“ Robert schreibt: „Du vervollständigst mich als Componisten wie ich Dich. Jeder Deiner Gedanken kommt aus meiner Seele, wie ich ja meine ganze Musik Dir zu verdanken habe.“ Das Paar geht vor Gericht, um die Heiratserlaubnis zu bekommen. Der Prozess dauert. Erst am 12. September 1840, einen Tag vor Claras 21. Geburtstag, heiraten die beiden.
Clara und Robert Schumann in Leipzig
Am nächsten Tag ziehen die beiden in ihr erstes gemeinsames Domizil in der Inselstraße in Leipzig. Hier verbringt das Paar seine ersten glücklichen Ehejahre, hier komponiert Robert Schumann einige seiner bedeutenden Werke. Clara und Robert Schumann führen eine Künstlerehe: er Komponist, sie Pianistin. In ihren Konzerten spielt sie immer häufiger Stücke von ihrem Mann. So wird Robert Schumann als Komponist immer bekannter.





Noch heute sind die beiden in dem Haus in der Inselstraße gegenwärtig: Das „Schuhmann-Haus“ beherbergt eine umfangreiche Ausstellung zu Clara und Robert Schumann und erzählt ihre Geschichte von den Anfängen bis zum Ende, das sich allerdings fast nur um Clara dreht. Als sie 36 Jahre alt ist, stirbt Robert Schumann. Clara ist auf sich alleine gestellt und muss die Familie – acht Kinder – ernähren. Sie reist jahrzehntelang durch Europa und gibt Konzerte, später unterrichtet sie mehr. Nach mehr als 60 Jahren tritt Clara Schumann mit 71 Jahren zum letzten Mal öffentlich auf.
Frauen in der Musik in Leipzig: Weibliche Lebenswelten
Wer heute durch das „Schumann-Haus“ geht, hat den Eindruck, das Museum sei Clara Schuhmann gewidmet. Ihre Geschichte wird ausführlich erzählt – beinahe ausführlicher als die von Robert Schumann. Eine Seltenheit, denn die Musikstadt Leipzig wird gerne über ihre prominenten Männer erzählt: Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Edvard Grieg, Gustav Mahler oder eben Robert Schumann. Doch anders als vermutet haben nicht nur Männer Musikgeschichte geschrieben.

Viele spannende Frauen haben Leipzig mit ihrer Musik und ihrer Geschichte geprägt. Sie standen zwar meist unbeachtet im Schatten der Männer, zogen aber im Hintergrund die Fäden. Sie komponierten, sangen, musizierten – und standen nur in der zweiten Reihe, weil sie Frauen waren. Heute bekommen die Frauen in der Musik in Leipzig wieder ein Gehör: Seit 2024 richten Leipzigs Musikmuseen den Blick auf starke Frauen und weibliche Lebenswelten in der Musikgeschichte der Stadt.
Frauen in der Musik in Leipzig: Mendelssohn-Haus
Einer der bedeutendsten Musiker der Romantik war Felix Mendelssohn Bartholdy. Zwölf Jahre lang war sein Lebensmittelpunkt Leipzig. Als Gewandhauskapellmeister prägte er das musikalische Leben der Stadt. Zu seinen Ehren wurde am 4. November 1997, an seinem 150. Todestag, das „Mendelssohn-Haus“ eröffnet. Das Museum befindet sich in einem spätklassizistischen Bau aus dem Jahre 1844 und ist die einzig erhalten gebliebene Wohnstätte von Felix Mendelssohn Bartholdy. Mit seiner Familie lebte er in der Beletage.






Das Haus wird heute als Musiksalon genutzt und ist das weltweit einzige Mendelssohn-Museum. Arbeitszimmer und Salon wurden originalgetreu wiederhergestellt, zu sehen sind unter anderem originales Mobiliar, Brief- und Notenautographe, Erstdrucke sowie einige der Aquarelle Mendelssohns. Ein Highlight ist das im Jahr 2014 eröffnete Effektorium. Felix Mendelssohn Bartholdy setzte als Dirigent Maßstäbe, die das Dirigieren bis heute prägen. Im Erdgeschoss des Hauses können Besucher:innen in einer weltweit einmaligen Installation interaktiv ein Orchester dirigieren.




Fanny Hensel & Cécile Mendelssohn Bartholdy
Im November 2017 folgte eine Erweiterung, die den Frauen der Familie Mendelssohn Bartholdy Platz macht. Hier dreht sich alles um Fanny Hensel. Die ältere Schwester von Felix Mendelssohn Bartholdys erhält gemeinsam mit ihm eine umfassende musikalische Ausbildung. Schon im Teenageralter ist sie eine großartige Pianistin und Komponistin, steht aber in zweiter Reihe. Als Fanny 14 ist, macht ihr Vater ihr klar: Talent bei einer Frau ist schön, ihre primäre Lebensaufgabe sei aber das Dasein einer Ehefrau und Mutter.






Die Geschwister sind einander eng verbunden. Fanny wird zur musikalischen Ratgeberin und scharfen Kritikerin ihres Bruders, komponiert und konzertiert allerdings selbst im Schatten. Sie tritt nur in den so genannten Sonntagsmusiken auf: Das sind halb-offizielle Konzertveranstaltungen, die seit dem Umzug der Familie nach Berlin regelmäßig in Leipzig stattfinden. Die Geschwister spielen Stücke zeitgenössischer Komponisten, aber auch Fannys Werke. Es ist die einzige Chance, mit ihrem Talent zu glänzen.
Ein Dasein in zweiter Reihe erlebt auch Cécile Mendelssohn Bartholdy. Als 18-Jährige lernt sie den acht Jahre älteren Felix Mendelssohn Bartholdy kennen. Ihre musikalische Ausbildung erhält sie im Frankfurter Cäcilienverein. Musikalisch längt nicht so talentiert wie etwa Fanny Hensel, schreibt sie nicht mit ihrer Musik Geschichte. Sie gilt als smarte Familienmanagerin, bildschöne und kunstsinnige Frau und Verwalterin des Nachlasses ihres Mannes. Seit 2024 kann man sich auf ihre Spuren begeben. Im Gartenhaus des „Mendelssohn-Hauses“ zeigt die Sonderausstellung „Die unbekannte Schöne“ die Lebensgeschichte von Cécile Mendelssohn Bartholdy.






Unsichtbare Frauen in der Musik
In der Literatur finden sich wenige Informationen über Cécile Mendelssohn Bartholdy. Ähnlich ist es bei anderen Frauen in der Musik in Leipzig. Sie verschwanden irgendwann aus den Lexika. 1732 fand man zahlreiche Sängerinnen und Komponistinnen im „Musikalischen Lexicon“ von Gottfried Walther, dem ersten deutschsprachigen Musiklexikon. Hundert Jahre später sind weibliche Namen im „Musikalischen Conversations-Lexikon“ von August Gathy Mangelware. Er spricht Frauen jede Musikalität ab. Zum Beispiel den Töchtern von Johann Sebastian Bach. Dabei hatte der das Talent der Bach-Frauen gelobt. Bach schrieb an einen Freund, dass seine Frau Anna Magdalena „einen sauberen Sopran“ singe und seine „älteste Tochter nicht schlimm einschlägt“.

Es gibt kaum Quellen zum Leben von Johann Sebastian Bach, noch weniger Informationen finden sich über die Frauen der Familie. Heute weiß man aber: Viele von ihnen waren talentiert. Maria Hübner, Wissenschaftlerin und ehemalige Mitarbeiterin des Bach-Archivs, konnte 33 Frauen aus der Bachfamilie ausfindig machen. Ihre Lebensgeschichten schrieb sie in dem Buch „Die Frauen der Bach-Familie“ auf. Damit will sie die Bach-Frauen als eigenständige Persönlichkeiten hervorheben: „Letztendlich stehen die Frauen im Musikleben auch heute noch im Schatten der Männer“.



Frauen in der Musik in Leipzig: Bach-Museum
Keine Frage: Johann Sebastian Bach gilt als Leitfigur der Leipziger Musikgeschichte. 27 Jahre lang war die Thomaskirche seine Wirkungsstätte. Er war von 1723 bis 1750 Thomaskantor in Leipzig und leitete den renommierten Thomanerchor. In seiner Zeit in Leipzig entstand ein Großteil seiner Werke. Am Thomaskirchhof thront mit dem Bosehaus einer der bedeutendsten Renaissancebauten Leipzigs. Hinter den historischen Mauern befindet sich das Bach-Archiv mit dem dazugehörigen Museum.





Das „Bach-Museum“ gibt mit einer 450 Quadratmeter großen Dauerausstellung spannende Einblicke in die Welt von Johann Sebastian Bach. Zu sehen sind unter anderem kostbare Instrumente, Dokumente und Kunstwerke. Von den Frauen der Bach-Familie ist leider wenig zu sehen. Dabei gäbe es viel zu erzählen, wie Maria Hübner in ihrem Buch verrät. Die Bach-Frauen hielten ihren komponierenden Männern und Vätern nicht nur den Rücken frei und managten die Familien, sie fertigten Partituren in Schönschrift, führten den Musikalienhandel oder gaben posthum die Werke der Männer heraus. Einige waren sogar selbst professionelle Sängerinnen.



In zweiter Reihe: Anna Magdalena Bach
Ein Beispiel ist die angesehene Sopranistin Anna Magdalena Wilcke. Am Hof des Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen lernt sie Johann Sebastian Bach kennen. Bach ist hier seit 1717 als Hofkapellmeister angestellt, Anna Magdalena als talentierte Sängerin. Sie verdient in der Hofkapelle das dritthöchste Gehalt nach Bach. 1721 heiraten die beiden – und Anna Magdalena geht nicht als Musikerin, sondern als Frau von Johann Sebastian Bach in die Geschichte ein.



Zwar ist Bach in Leipzig nicht nur für den Thomanerchor, sondern auch für die gesamte Musik in den Leipziger Stadtkirchen zuständig, Anna Magdalena Bach darf allerdings nicht auftreten. Solistischer Gesang von Frauen ist in den städtischen Kirchen verboten. Dennoch macht sie von sich reden: Als Johann Sebastian Bach stirbt, gibt sie sein Lehrwerk „Die Kunst der Fuge“ posthum heraus und macht ihren Namen sichtbar durch das „Notenbüchlein der Anna Magdalena Bach“.
Frauen in der Musik in Leipzig: Stadtgeschichtliches Museum
Das Herz von Leipzig ist der Markt. Auf dem ein Hektar großen Platz spielte sich einst ein Großteil des Warenumschlags der Leipziger Messe ab. 1497 wurde die Stadt von Kaiser Maximilian als Reichsmesse proklamiert und erwarb damit Sonderrechte zur Vereinfachung von Handelsgeschäften. So wurde Leipzig zur ersten Messestadt der Welt. Das älteste Gebäude steht im Osten des Platzes. Das Alte Rathaus wurde 1556 errichtet und gilt als einer der bedeutendsten deutschen Profanbauten der Renaissance. Mit einer Länge von 91 Metern ist es das Wahrzeichen von Leipzig.



In seinem Inneren befindet sich die Ständige Ausstellung des „Stadtgeschichtlichen Museums“, besichtigen kann man unter anderem den historischen Festsaal, die Ratsstube, die Schatzkammer und die Kellergewölbe. Neu im „Stadtgeschichtlichen Museum“ ist der digitale Rundgang „MXM – Museum Ex Machina“, der sich unter anderem auf die Spuren von ein paar Frauen begibt, die Leipzig einst prägten. Zum Beispiel die gefeierte Sängerin und Salonière Livia Frege. Sie debütiert am 9. Juli 1832 im Alter von 14 Jahren im Leipziger Gewandhaus. Felix Mendelssohn Bartholdy beschreibt sie damals als „unsere hiesige Nachtigall und Lerche“ und widmet ihr mehrere Lieder.






Leipzig: Familie Frege
Nur wenige Schritte entfernt liegt das Fregehaus in der Katharinenstraße. Das barocke Kaufmannshaus wurde vermutlich im Jahr 1535 erbaut. Das aus vier Flügeln bestehende Gebäude ist um einen rechtwinkligen Innenhof herum angelegt. Seinen Namen verdankt das Fregehaus dem Bankier Christian Gottlob Frege II., der es 1782 erwarb. Sogar Johann Wolfgang von Goethe hatte ein Bankkonto beim Bankhaus Frege.





Seit dem Jahr 2014 befindet sich in dem Gebäude das „Hotel Fregehaus“. Die Zimmer sind auf drei Etagen um den Hof verteilt. Gastgeberin Sabine Fuchshuber ist studierte Architektin und ließ das Gebäude mit jeder Menge Bedacht zum Hotel umbauen, sodass es seinen historischen Charme behalten konnte. Die weitverzweigte Familie Frege ist heute noch mit ihrem Namen bekannt. Nachfahren der Familie sind unter anderem die Sängerin Livia Frege, der erste Präsident des Bundesverwaltungsgerichtes Ludwig Frege und Andreas Frege, bekannt als Campino, Frontmann der Toten Hosen.
Museum Zum Arabischen Coffe Baum
Vom Marktplatz geht es durch das Barfußgässchen zu einem Superlativ: Eines der ältesten Kaffeehäuser der Welt steht mitten in der Altstadt von Leipzig. Seit 1711 wird im Haus „Zum Arabischen Coffe Baum“ nachweislich Kaffee ausgeschenkt. Damit zählt es neben dem „Café Procope“ in Paris zu Europas ältesten durchgehend betriebenen Kaffeeschenken. Seit jeher war das Kaffeehaus Anziehungspunkt für berühmte Gäste. Einst schlürften der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched oder der Komponist Robert Schumann hier Kaffee, zu DDR-Zeiten die Mitglieder des 1978 gegründeten Künstlercafés, später Prominente wie Maximilian Schell, Mario Adorf oder Kurt Masur.





Heute lockt das Kaffeehaus mit Kulinarik und Kultur. Erdgeschoss und erstes Obergeschoss gehören der Gastronomie, in den oberen Etagen befindet sich ein Museum. In 16 Räumen dreht sich alles um Kaffee: von der strengen Kaffeehausordnungen des 18. Jahrhunderts bis zur Kaffeekrise der DDR, von kolonialen Verflechtungen des Kaffeeanbaus bis zu globalen Handelsbeziehungen. Die Ausstellung dreht sich aber auch um die Frauen, die als Wirtinnen entscheidend zum Erfolg beitrugen. Im Mittelpunkt steht Johanna Elisabeth Lehmann, die das Haus nach dem Tod ihres Mannes über zwei Jahrzehnte lang führte. Unter ihrer Leitung entwickelte sich der „Coffe Baum“ zu einem kulturellen Zentrum, wo sich Intellektuelle und Künstler trafen.







Leipzig: Starke Frauen der Stadt
Kulinarik und Kultur liegen in Leipzig nahe beieinander. So auch am Naschmarkt auf der Rückseite des Alten Rathauses. Benannt nach dem einstigen Handel mit Obst, das früher als Naschwerk galt, ist der Naschmarkt heute ein toller Ort, um in historischem Ambiente einen Kaffee zu trinken – mit Blick auf die Alte Börse, die Leipzigs ältestes Versammlungsgebäude der Kaufmannschaft und das älteste Barockbauwerk der Stadt ist. Davor thront ein Denkmal von Goethe, das den Dichterfürsten in jungen Jahren zeigt: Er kam mit 16 nach Leipzig, um zu studieren.



Wenn Daniela Neumann bei ihren Stadtführungen am Naschmarkt stehen bleibt, dann allerdings nicht wegen Goethe. Ihre Touren widmen sich ausgewählten Leipziger Frauen aus Geschichte und Gegenwart. Sie bietet zwei verschiedene Stadtführungen zu Leipzigs Frauen an, eine dritte ist in Ausarbeitung. Dabei geht es nicht nur um Frauen in der Musik, sondern um Pionierinnen, die die Stadt mit ihren Visionen geprägt haben. Die Frauenporträts führen an bekannte und weniger bekannte Orte der Leipziger Innenstadt.
Starke Leistung: Leipziger Kochbuch
Am Naschmarkt erzählt sie von Susanna Eger, die das erste Kochbuch für den privaten Haushalt schrieb. 1706 erschien das „Leipziger Kochbuch“, in dem sie ihr Wissen um die sächsische Küche in rund 900 Rezepten aufschrieb. Das Besondere waren die allgemeinverständliche Sprache, die bodenständigen Rezepte, die praktische Anwendung und zahlreiche Begriffe aus der sächsischen Mundart.

In der Erstauflage wurde Susanna Egers noch unter dem Kürzel „S. E.“ gedruckt, ab der zweiten Auflage aus dem Jahr 1712 war ihr Name auf dem Titel zu lesen. Das Kochbuch wurde auch erweitert, unter anderem durch 30 ernährungswissenschaftliche Fragen, ein Lexikon für Lebensmittel und Gewürze und Tabellen zum Einmaleins und Umrechnen von Maßen, Gewichten und Münzen. Der Erfolg Susanna Egers reichte so weit, dass sie 1715 von Gottlieb Siegmund Corvinus in sein „Frauenzimmer-Lexicon“ aufgenommen wurde: als „in der Koch-Kunst wohlerfahrnes und geschicktes Weib“.
Leipzig: Frauen machen Geschichte
Daniela Neumann lenkt den Blick auf kleine Details bei ihren Stadtführungen. Oft muss man suchen, worauf sie deutet. Da eine kleine Tafel über Luise Adelgunde Viktorie Gottsched, eine der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. Jahrhunderts, dort ein verstecktes Schild über Christiane Benedikte Naubert, die ihre Sammlung der „Neuen Volksmärchen der Deutschen“ lange vor den Brüder Grimm veröffentlichte.




Vor der Universität bleibt sie stehen und erzählt von Hope Bridges Adams Lehmann. Sie war sie die erste Frau, die in Deutschland ein Medizinstudium mit dem Staatsexamen abschloss. Zum Wintersemester 1876/77 schrieb sie sich als Gasthörerin an der Universität Leipzig ein, da ein Frauenstudium im Deutschen Reich zum damaligen Zeitpunkt anders nicht möglich war. 1896 veröffentlichte sie „Das Frauenbuch. Ein ärztlicher Ratgeber für die Frau in der Familie und bei Frauenkrankheiten“. Das Werk galt damals als wegweisend für die Gesundheitsfürsorge für Frauen.





Frauen wie Hope Bridges Adams Lehmann gibt es viele. Heute haben sie endlich mehr Sichtbarkeit. Auch dank des Online-Portals „Leipziger Frauenporträts“, das vom Referat für die Gleichstellung von Frau und Mann der Stadt Leipzig und der Louise-Otto-Peters-Gesellschaft e. V. geschaffen wurde. Das öffentlich zugängliche Kompendium gibt Auskunft über die Leistungen und Lebenswege von historischen Leipzigerinnen – vom 15. Jahrhundert bis in die jüngste Vergangenheit.
Frauen in der Musik in Leipzig: Musikinstrumentenmuseum
Auch das „Musikinstrumentenmuseum der Universität Leipzig“ gibt den Frauen Leipzigs einen Raum. In Themenführung wird Musikerinnen, Komponistinnen und Instrumentenbauerinnen wie Francesca Caccini oder Nannette Streicher-Stein sowie musikalische Aktivitäten von Frauen seit der frühen Neuzeit mehr Sichtbarkeit gegeben. Das Museum der Universität Leipzig ist im „Neuen Grassimuseum“ am Johannisplatz untergebracht. Seinen Namen verdankt das Haus dem Kaufmann und Mäzen Franz Dominic Grassi.



Auf dem eindrucksvollen Gelände finden sich gleich drei Museen mit unterschiedlichen Themen: das „Museum für Angewandte Kunst“, das „Museum für Völkerkunde zu Leipzig“ und eben das „Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig“. Es gehörte mit dem „Museum in Brüssel“ und dem „Museum in der Cité de la musique“ in Paris zu den größten Musikinstrumenten-Museen Europas. Ausgestellt sind rund 10.000 Objekte, darunter wertvolle europäische und außereuropäische Instrumenten, kostbare Stücke aus der Zeit der Renaissance und des Barock sowie der Leipziger Bach-Zeit.





Starke Frauen: Baumwollspinnerei in Leipzig
Nicht nur in der Musik und in der Kunst, auch in der Industrie haben Leipzigs Frauen Spuren hinterlassen. Und Großes geleistet. Das merkt man im Leipziger Stadtteil Plagwitz. Hier gibt es viel Industriegeschichte von einst aufzuspüren. Die schönste von allen findet man in der „Leipziger Baumwollspinnerei“, die 1884 gegründet wurde und mit über zehn Hektar Fläche die größte Baumwollspinnerei Kontinentaleuropas war. In den Hochzeiten der Baumwollproduktion war auf dem Gelände eine Fabrikstadt mit über 20 Produktionsgebäuden und Arbeiterwohnungen.






Bis zu 4.000 Menschen arbeiteten hier bis 1989. Nach der Wiedervereinigung wurde der Betrieb eingestellt. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Kreative, um den Leerstand zu nutzen – erst geduldet, heute genehmigt. Heute ist die Spinnerei ein Zentrum zeitgenössischer Kunst. Mittlerweile gibt es rund 100 Künstlerateliers sowie zahlreiche Galerien und Ausstellungsflächen. Die Rolle der Frauen war in der „Leipziger Baumwollspinnerei“ prägend. Schon im 19. Jahrhundert trugen sie als Arbeitskräfte in der Produktion maßgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg der Spinnerei bei.






Heute geben Kunst-Pionierinnen wie Lætitia Gorsy Frauen mehr Sichtbarkeit. In ihrer Galerie stellt sie die Arbeit von Künstlerinnen in den Mittelpunkt und setzt so ein Zeichen für Gleichberechtigung in der Kunstwelt. Ausgestellt und gefördert werden nur die Werke von Frauen. Auch Claudia Biehne ist eine der Frauen auf dem Areal der „Leipziger Baumwollspinnerei“. In Halle 20 – in der zufälligerweise nur Frauen ihre Ateliers haben – schafft sie in ihrem Porzellanatelier einzigartige Porzellankunstwerke. Jedes Werk erzählt von Kreativität, Handwerkskunst und der Bedeutung von Frauen in der zeitgenössischen Porzellankunst.






Frauen in der Musik in Leipzig: Jazztage Leipzig
Zeitgenössisch und zugleich eines der musikalisch spannendsten Events Leipzigs sind die „Leipziger Jazztage“. Das internationale Festival für zeitgenössischen Jazz zählt zu den traditionsreichsten und renommiertesten Jazzfestivals in Deutschland. Jedes Jahr im Herbst stehen zehn Tage lang internationale Künstler:innen auf den Bühnen der Stadt. Das Besondere sind viele ausgefallene Spielorte, darunter die Leipziger Oper, das Völkerschlachtdenkmal, die Moritzbastei und diverse Kirchen.



2025 war das Abschlusskonzert der „Leipziger Jazztage“ ein Doppel-Gig von zwei Frauen. Rebekka Salomea teilte sich mit DJ Allynx die Bühne im „Werk2“. 2026 will man die Frauenquote noch mehr erhöhen. Denn obwohl die Präsenz von Frauen auf Jazzfestivals in den letzten Jahren zugenommen hat, stehen nachwievor mehr Männer auf den Bühnen. „Historisch gesehen war die Jazzszene lange Zeit von Männern dominiert. Frauen im Jazz brauchen noch mehr Sichtbarkeit“, sagt Jil Noack, Head of Press and Public Relations des Jazzclubs Leipzig.



Praktische Infos
Anreisen
Mit der Bahn bis zum Hauptbahnhof Leipzig und ca. zehn Minuten zu Fuß in die Innenstadt. Mit dem Flugzeug zum Flughafen Leipzig/Halle und mit der S5 in 16 Minuten zum Hauptbahnhof oder in 19 Minuten zum Leipziger Markt.

Herumkommen
Der öffentliche Verkehr in Leipzig ist prima erschlossen. Perfekt für unterwegs ist die App LeipzigMOVE, in der man Routenvorschläge und praktische Infos erhält und das Ticket direkt kaufen kann. Wer länger in der Stadt ist und viel besichtigen möchte, fährt mit der Leipzig Card am besten: Der öffentliche Verkehr in Leipzig ist ebenso inkludiert wie viele Ermäßigungen für Freizeiteinrichtungen.

Übernachten
Nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt liegen zahlreiche Hotels. Eines davon ist das „Radisson Hotel Leipzig“: Erst Ende 2024 eröffnete das moderne Hotel, das das erste Hotel der Marke Radisson in Deutschland ist. Die Marke steht für skandinavisch inspirierte Gastfreundschaft, es gibt über 224 stilvoll eingerichtete Zimmer, dazu ein Fitnesscenter, eine Bar und ein Frühstücksrestaurant. Dank der zentralen Lage sind die Sehenswürdigkeiten Leipzigs leicht zu erreichen.



♥ Offenlegung
Dieser Artikel entstand in einer bezahlten Zusammenarbeit mit Leipzig Tourismus und Marketing GmbH. Meine Meinung ist aber völlig unvoreingenommen und stets meine eigene. Weitere Infos über Leipzig gibt es auf www.leipzig.travel.

♥ Weiterreisen in Leipzig
Lässiges Leipzig: 40 Sehenswürdigkeiten, Highlights & Insidertipps für Leipzig
Friedliche Revolution in Leipzig: 35 Jahre Freiheit und Demokratie
Plagwitz: Industriekultur und Individualität im Leipziger Westen
Radfahren in Leipzig: Radtour zum Cospudener See im Leipziger Neuseenland
Leipzig to go: Die coolsten Führungen und Touren in Leipzig
Märchenhaft: Die schönsten Burgen und Schlösser in der Region Leipzig
Weihnachtsmärkte in Leipzig: Adventszeit in Leipzig zwischen Traditionen und Trends