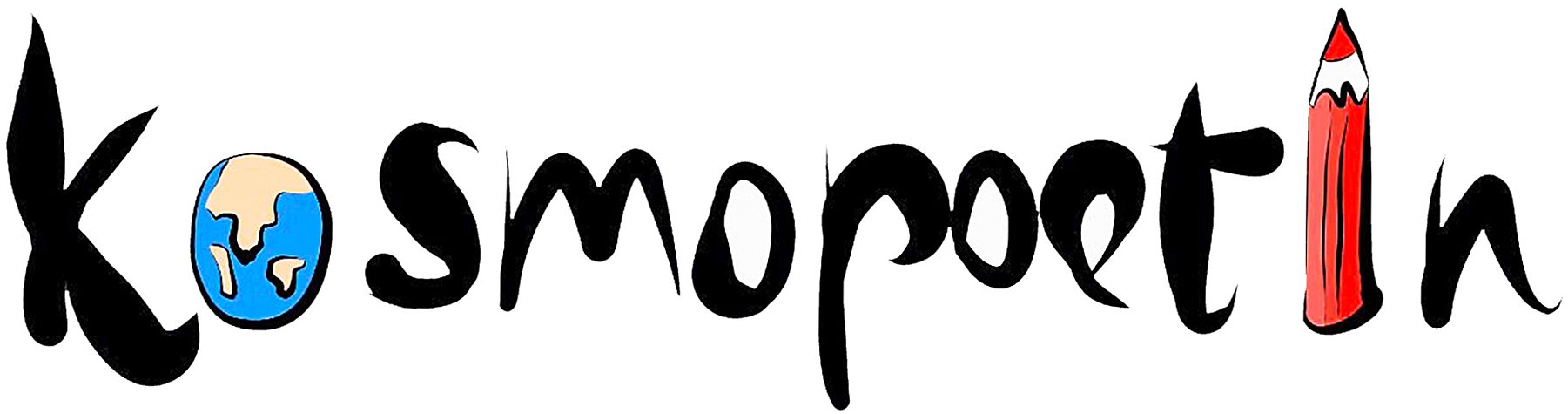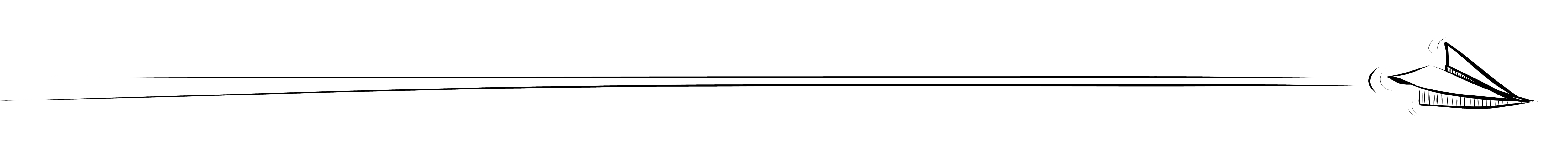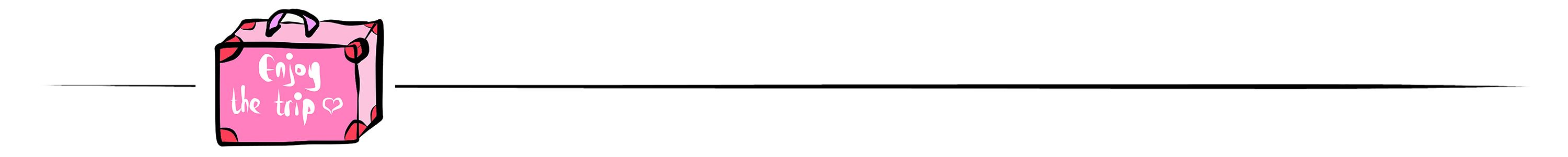Im Kanton Graubünden, ganz im Osten der Schweiz, erstreckt sich das Landwassertal zwischen weiten Alpentälern und mächtigen Bergriesen. Mittendrin liegen das Walserdorf Klosters und der Weltkurort Davos. Als 1853 das Davoser Höhenklima als besonders heilsam für Lungenkranke erklärt wurde, wuchs das Bergdorf binnen weniger Jahre zur höchsten Stadt Europas an.

Davos Klosters: Lieblingsplatz zwischen Liegekuren und Landwasserviadukt ♥ Lesezeit: 9 Minuten
Die Rhätische Bahn schraubt sich durch Alpentäler und Talböden, stets die Graubündner Gipfel an ihrer Seite. Sie bohrt sich durch den Bauch der Berge, überwindet Brücken und Viadukte, ächzt mal nach oben, mal nach unten. Das Landwasser blitzt unterwegs immer wieder hervor. Der 30,5 Kilometer lange Fluss ist eines der Hauptquellgewässer des Alpenrheins und trennt die Albula-Alpen von den Plessuralpen.

Das Landwassertal ist berühmt für die Stadt Davos und die Rhätische Bahn, die dem Tal auf ganzer Länge folgt. In Davos bleibt sie schnaufend stehen. Auf 1.560 Metern liegt hier die höchstgelegene Stadt Europas. Davos umfasst beinahe das gesamte Landwassertal in Graubünden und macht weltweit auf sich aufmerksam, wenn Anfang des Jahres beim Weltwirtschaftsforum Prominente aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft über wichtige Fragen der Zeit diskutieren. 1971 traf man sich zum ersten Mal in Davos, ganz im Osten der Schweiz.

Weltkurort Davos
Der Weg zur Berühmtheit geschah allerdings weit früher. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts trug Davos den Titel „Weltkurort“. Ab 1853 erklärte der deutsch-schweizerische Mediziner Alexander Spengler das Davoser Höhenklima als gesundheitsfördernd und heilsam für Lungenkranke, insbesondere bei Tuberkulose. „Der Weg zu Kraft und Gesundheit führt über Davos“, ist heute noch auf historischen Werbeplakaten zu lesen. So wuchs Davos über sich hinaus: Das Bergdorf mit 1.700 Einwohner:innen mauserte sich innerhalb weniger Jahre zur höchsten Stadt Europas, in der 10.000 Menschen lebten und 25.000 sich auskurierten.

Die beiden größten Fraktionen in Davos, Dorf und Platz, liegen im fast ebenen oberen Talabschnitt und sind mittlerweile miteinander verschmolzen. Wer heute in den Höhen über Davos unterwegs ist, mag die Nase rümpfen über die wenig schöne Flachdacharchitektur des Ortes, tatsächlich gibt es aber einen Grund für diesen Baustil. Nichts sollte den Lichteinfall in die Sanatorien mindern. Deshalb setzte man auf lichtdurchflutete Räume, der Sonne zugewandte Balkone und Flachdächer, die Lawinen abhalten sollten.
Davos, das neue Mekka der Schwindsüchtigen
Die beiden ersten Winterkurgäste kamen 1865 nach Davos. Um 1870 gab es Platz für 200 Lungenkranke, zehn Jahre später waren es 1.474 Betten. Das Geschäft mit der Krankheit wurde zum Boom: Davos warb ab dem Jahr 1874 mit dem durchaus makaber klingenden Slogan „Davos, das neue Mekka der Schwindsüchtigen“ um neue Gäste.

Der Bau der Eisenbahnlinie von Landquart nach Davos und die Eröffnung 1890 sorgte für den Rest. Immer mehr Hotels, Pensionen und Villen eröffneten. Vor allem aber Sanatorien: 1889 das „Sanatorium im Park“, 1900 das „Sanatorium Schatzalp“. Im Laufe der Zeit wuchs die Zahl der Sanatorien auf 18 an. Ein Aufenthalt dauerte mindestens drei Monate. Da die Rückfahrt nicht planbar war, verkaufte die Bahn Fahrkarten mit dem Aufdruck „Gültig bis zur Heilung“. Man brauchte eben Zeit in Davos.

Sanatorium auf der Schatzalp
Hoch oben auf der Schatzalp scheint auch heute die Zeit langsamer zu vergehen. Auf einer Anhöhe thront über Davos ein opulentes Jugendstilgebäude, das in den Jahren von 1898 bis 1900 von den Zürcher Architekten Otto Pfleghard und Max Haefeli aus dem Boden gestampft wurde. Es galt Anfangs des 20. Jahrhunderts als fortschrittlichste Heilstätte der Region. Die 304 Höhenmeter absolviert die Standseilbahn in fünf Minuten, bis sie auf 1.861 Meter vor der Tür des heutigen „Hotel Schatzalp“ hält, das als Sanatorium für Tuberkuloseerkrankte einst für Furore sorgte.




Die Architektur ist weitgehendst erhalten, gerade erst wurden die überdachten Balkone erneuert. Diese spielten eine wichtige Rolle. Der Heilplan setzte auf strenge Luftliegekuren, bei denen die Patient:innen fünf bis sieben Stunden täglich auf Balkonen oder in unbeheizten offenen Hallen lagen. Dazu schwor man auf eine kalorienreiche Kost: Es gab ein üppiges Frühstück, oftmals sogar zwei, zu Mittag ein 4-Gang- und am Abend ein 5-Gang-Menü. Und weil das nicht reichte, wurden zusätzlich Zwischenmahlzeiten gereicht, außerdem literweise Milch.





Weil das Liegen komfortabel sein sollte, entwickelte man einen eigenen Liegestuhl. Der sogenannte „Davoser Liegestuhl“ von Peter Dettweiler hatte eine Matratze, die optimal dem Körper angepasst war, einen Fellsack, eine Wolldecke und eine warme Bettflasche. Bald war der Stuhl in allen Schweizer Sanatorien präsent. „Es konnte für das Wohlsein ruhender Glieder überhaupt nicht humaner gesorgt sein als durch diesen vorzüglichen Liegestuhl“, schwärmte einst Thomas Mann.

Thomas Mann: „Der Zauberberg“
Thomas Mann ist seit einem Jahrhundert eng verwoben mit Davos: Sein Roman „Der Zauberberg“ beruht auf einem Aufenthalt seiner Frau Katia in einer Lungenklinik. Der namensgebende Zauberberg wird mit der Schatzalp assoziiert, obwohl Katia im Waldsanatorium zur Kur weilte, dem heutigen „Waldhotel Davos“. 100 Jahre später gibt es ein doppeltes Jubiläum: 2024 feierte Davos das 100-jährige Erscheinen des Romans, 2025 den 150. Geburtstag von Thomas Mann.

Katia Mann verbrachte 1912 ein halbes Jahr in Davos, um eine Tuberkulose auszukurieren. Thomas Mann kam zu Besuch – und war fasziniert von der Welt der Höhenkliniken, ihrer Patient:innen und der abgelegenen Welt im Davoser Hochland. Er begann, den Davoser Kosmos akribisch zu erforschen. Davos bedeutet im Rätoromanischen „dahinten“ – und so fühlte sich Thomas Mann auch. Abgeschieden in den Alpen, aber angezogen von der Krankheit, um die sich in Davos alles drehte. Kurios: 50 Jahre später stellte sich heraus, dass Katia Mann nie lungenkrank gewesen war.
Davos Klosters: Waldhotel Davos
Die Menschen waren nicht begeistert, als der 1.000-seitige „Zauberberg“ erschien. Sie hätten es als „kreditschädigend“ angesehen, heißt es noch heute. Manche erkannten sich selbst zwischen den Zeilen, andere fürchteten um den Ruf als Weltkurort. Trotz alledem wurde der Roman zum Erfolg – für Thomas Mann genauso wie für Davos. Denn noch heute kommen viele Gäste, um sich auf die Spuren von Thomas Mann zu begeben. Spätestens, als er den Literaturnobelpreis erhielt, söhnten sich die Davoser mit dem „Zauberberg“ aus.



Im „Waldhotel Davos“, das am Waldrand an der „Hohen Promenade“ steht, weilte Katia Mann. Hier ist heute noch ein Kuraufenthalt von einst nacherlebbar. Auf den nach Süden ausgerichteten Balkonen stehen noch immer die Ruhebetten, deren Bequemlichkeit Thomas Mann lobte. Immer wieder begegnet man historischen Fotos, unter anderem Thomas Mann nebst Dichter-Kollegen Hermann Hesse. Das Zimmer 307, in dem Katia Mann nächtige, hat heute die Nummer 34, im fünften Stock kann man in der „Thomas-Mann-Suite“ einchecken. Das Highlight ist ein gut erhaltenes, historisches Sanatoriumszimmer von anno dazumal.

Davos Klosters: Thomas-Mann-Weg
Das verbindende Element zwischen dem „Waldhotel Davos“ und der Schatzalp ist ein sich sanft durch den Wald mäandernder Wanderweg: Der 2,8 Kilometer lange Thomas-Mann-Weg verbindet die beiden „Zauberberg“-Hauptschauplätze miteinander. Unterwegs stehen zehn Tafeln mit Zitaten aus dem Roman. Es heißt, dass Thomas Mann selbst zahlreiche Spaziergänge durch das Gebiet gemacht haben soll. Oben auf der Schatzalp gibt es deshalb auch einen Thomas-Mann-Platz.




In unmittelbarer Nähe blüht und gedeiht es. Denn zur Schatzalp gehört das „Schatzalp Alpinum“, ein botanischer Alpengarten. Dabei handelt es sich um den einzigen botanischen Garten in Graubünden, in dem über 3.500 Pflanzenarten aus allen Gebirgszonen der Welt wachsen: den Alpen, den Pyrenäen, dem Himalaya, den Appalachen, dem Kaukasus, den Drakensbergen oder den Neuseeländischen Alpen.






Das passt ja irgendwie zu einer Höhenklinik. Einzig: Ein Kraut, das die Tuberkulose heilen konnte, wächst hier nicht. Dafür brauchte es die Entdeckung des Penicillins und des Wirkstoffs Streptomycin, der die Krankheit rasant eindämmen konnte. Das machte die Davoser Luftkuranstalten ab Ende der 1940er Jahre überflüssig. Gab es 1918 noch 38 Sanatorien und Kliniken, sind es heute einige wenige, die die Kurortstradition fortführen.




Klosters: Schweizer Alpenflair
Das Gehirn spielt einem einen Streich, sobald man in Klosters steht, umgeben von üppig blühenden Almwiesen, dunkel gebeizten Holzhäusern und den Graubündner Bergriesen. Man fühlt sich den Gipfeln näher als in Davos, ist aber tatsächlich tiefer: Klosters liegt am Ende des Prättigaus, dreihundert Meter unterhalb der Stadt Davos. Nur 3.800 Menschen leben in dem Bergdorf. Wo das Alpenflair in Davos zu fehlen scheint, ist es in Klosters allgegenwärtig. Vor allem aber ist Klosters unprätentiös. Da wundert es nicht, dass König Charles III. seit Jahrzehnten über die Madrisa wedeln kann, ohne groß beachtet zu werden.





Den Aufschwung erlebte Klosters im Jahr 1889. Damals wurde die Bahnstrecke Landquart–Davos Platz der Rhätischen Bahn in Betrieb genommen. Der Fremdenverkehr erlebte fortan einen Boom. 1921 wurde ein heizbares Schwimmbad, 1950 die Bergbahn Gotschna, 1966 die Bergbahn Madrisa eröffnet. Im Laufe der Jahrzehnte wuchsen dann die Ortsteile Platz (auf 1.206 Meter) und Dorf (auf 1.124 Meter) zu einem großen Ganzen zusammen. Beide Orte werden heute auch gemeinsam vermarktet.





Geprägt wurde Klosters allerdings weit früher. Im 13. Jahrhundert wanderten zahlreiche Walser über die Alpen, viele ließen sich im heutigen Graubünden nieder. Da die besten Lagen bereits besetzt waren, bauten sie ihre typischen Häuser auf den steilen Wiesen oberhalb der Siedlungen. Die sonnenverbrannten Holzhäuser und auf Stelzen errichteten Holzspeicher für Vorräte prägen bis heute das Landschaftsbild von Klosters.
Klosters: Gadäwäg
Besonders in Monbiel, dem hintersten Walserdorf im Prättigau, ist die Walser-Architektur erhalten. Hier liegt auch der Startpunkt des „Gadäwäg“. Der Wanderweg führt über knapp vier Kilometer von Monbiel bis Russna. Vom höchsten Punkt des Tals blickt man bis zum Silvrettagletscher. Hauptdarsteller neben der Bergkulisse sind fünf alte Holzställe, die im Prättigauer Dialekt „Gadä“ heißen. Sie stehen verstreut auf den Weiden und laden unterwegs ein, die Vergangenheit der Walser zu entdecken. Jeder Stall erzählt eine andere Geschichte.





Im „Rütlistall“ erhält man Einblicke in die Tätigkeitsfelder von Tourismus und Landwirtschaft, im „Hennägadä“ dreht sich alles um die Heil- und Wirkkraft von einheimischen Kräutern, im „Bodästall“ um die Tiere der Klosterser Bauernhöfe. Der „Bärgstall“ setzt Klanginstallationen des Künstlers Corsin Vogel in Szene: mal muht eine Kuh, mal ertönen Arbeitsgeräusche wie Dengeln, Rechen oder Mähen, mal donnert ein Gewitter. Im „Kulturstall“ sind indes Ausstellungen von Künstler:innen der Region zu sehen.





Klosters: Nutli Hüschi
Vom Kulturstall auf dem „Gadäwäg“ sind es nur wenige Schritte bis zum „Nutli Hüschi“. In einem alten Walserhaus aus dem Jahr 1565 wurde ein Dorfmuseum eingerichtet, das die Geschichte der Walser nacherzählt. Der Name entstand nach dem Erbauer des Hauses, Christian Nutli, und dem Prättigauer Dialektwort für kleines Haus: Hüschi. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts wurde es als Wohnhaus benutzt und später als Museum eröffnet. 1996 baute man einen Stall im walserischen Originalstil an. Zu sehen sind im Original erhaltene Gegenstände wie Möbel, Werkzeuge und Spielsachen.





Das Holzhaus erzählt in mehreren Räumen von der Einfachheit eines Lebens in abgelegenen Regionen ohne fließendes Wasser und Elektrizität und von der Stärke der Walser, die jeglichen Herausforderungen trotzten. Zäh sollen sie gewesen sein, aber auch bescheiden und naturverbunden, gutmütig und gottesfürchtig. Eine riesige Bibel in der Stube erinnert an Abende, an denen sich die Familie hier versammelte, um darin zu lesen und das Wort Gottes von klein auf zu verinnerlichen.





Davos Klosters: Nostalgiezug
Es ist wieder die Rhätische Bahn, die ein Stück von Klosters und Davos weg und in die Vergangenheit führt. Der Nostalgiezug aus den 20er Jahren kommt auf der Strecke zwischen Davos und Filisur ins Ächzen: Er windet sich schnaufend durch 15 Tunnel und über 28 Brücken. Die Bahnstrecke Davos–Filisur ist eine meterspurige Schmalspurbahn, die eingleisig ausgeführt und seit 1919 elektrifiziert ist. Zwei Mal am Tag, zwischen Mai und Oktober, nimmt der Zug mit Bahnwagen der 1. und 2. Klasse und einem offenen Aussichtswagen seine Fahrt auf.





Wo die Rhätische Bahn ihre Gäste ausspuckt, wartet das nächste Highlight in Filisur, sprichwörtlich. Hier ragt das spektakuläre Landwasserviadukt in den Himmel. Die 65 Meter hohe und 136 Meter lange Eisenbahnbrücke gilt als ein Wahrzeichen der Bahngesellschaft und gehört als Bestandteil der Albulabahn seit 2008 zum UNESCO-Weltkulturerbe. 22.000 Züge tuckern pro Jahr über das Viadukt, täglich sind es etwa 60.

Ausflug von Davos Klosters: Landwasserviadukt
Der Bau der drei Hauptpfeiler von 1901 bis 1902 gilt als architektonische Meisterleistung. Sie wurden mithilfe eines Aufzugs einzeln in die Höhe gezogen – ohne Holzgerüste. Stattdessen wurde in jedem Turm ein eiserner Stützturm aufgestellt, der mit eingemauert wurde. Zwischen den Pfeilern verliefen kranartige, eiserne Brücken, die es ermöglichten, die Steine aus dem Talgrund zu heben. Ingenieur war der griechisch-schweizerischer Alexander Acatos. Nach ihm ist ein Aussichtspunkt benannt, von dem man einen tollen Ausblick hat.



Von Filisur gelangt man über eine Fußweg in einer halben Stunde zu jener Stelle im Wald, von wo aus das Viadukt perfekt zu sehen ist. Von hier geht es in 30 Minuten hinunter zum Fluss, unter dem Viadukt hindurch und zum Grillplatz mit Kiosk, der zu Füßen des Landwasserviadukt angelegt wurde. Auch hier ist das Staunen groß, wenn man nach oben blickt und dabei zusieht, wie die Züge über das Viadukt rattern.





Zurück geht es zu Fuß oder mit der Tschutschubahn, die gemächlich zum Bahnhof in Filisur gondelt. Ob die Fahrt mit dem Nostalgiezug oder der Tschutschubahn, das große Staunen an den Viewpoints oder Aktivitäten rund um Filisur: All das ist Bestandteil der „Landwasserwelt“, die im Juni 2025 eröffnet wurde. Im Fokus stehen die fünf Erlebniswelten „Bahn“, „Kultur“, „Landwirtschaft“, „Wald“ und „Wasser“ und Erlebnisse rund um das Landwasserviadukt.
Hotels in Davos Klosters
♥ Offenlegung
Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus Österreich. Meine Meinung ist aber völlig unvoreingenommen und stets meine eigene. Der Artikel enthält Empfehlungslinks. Bei einer Bestellung erhalte ich eine kleine Vermittlungsprovision – natürlich ohne Mehrkosten für meine Leser:innen.

♥ Weiterlesen
Spitze, Stiftsbezirk & Schokolade: 44 Highlights in St.Gallen
Vielfalt am Vierwaldstättersee: 13 Insidertipps für Luzern
Tipps fürs Tessin: Die 7 schönsten Stopps in der italienischen Schweiz
Traumurlaub im Tessin: 5 Highlights in Ascona